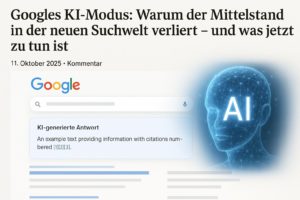KI im Vertragsmanagement:
Wie Einkaufsabteilungen mit Daten arbeiten – und worauf sie achten müssen
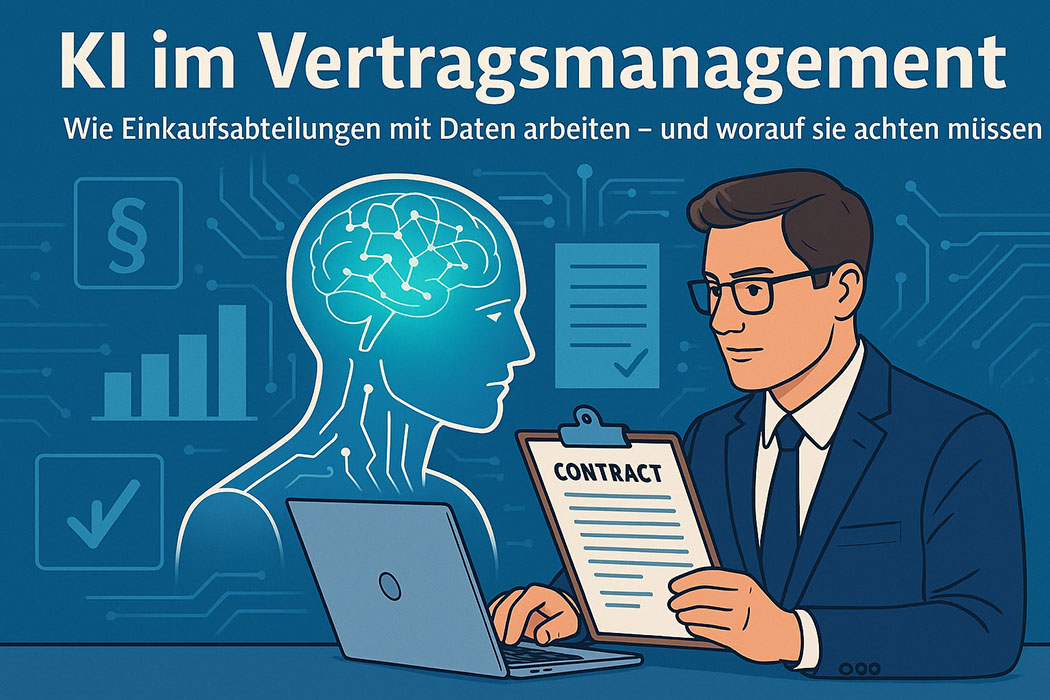
Verträge als Basis – nicht als Belastung
Lieferantenverträge, Rahmenvereinbarungen oder Service-Level-Agreements (SLAs): Im Einkauf bilden Verträge die Grundlage für Preise, Fristen, Qualitätsvorgaben und rechtliche Absicherung. Dennoch wird das Vertragsmanagement in vielen Unternehmen noch immer als rein administrative Tätigkeit gesehen. Das kann riskant sein – insbesondere in volatilen Märkten und unter wachsendem regulatorischem Druck.
Moderne Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), versprechen hier Entlastung. Doch nicht jede Lösung hält, was sie verspricht. Der gezielte Einsatz kann Abläufe beschleunigen und Fehler reduzieren – gleichzeitig steigen jedoch auch die Anforderungen an Datenschutz und Prozessverständnis.
KI kann mehr als nur automatisieren
Der Mehrwert von KI im Vertragsmanagement liegt nicht nur in der Automatisierung von Routineaufgaben. Intelligente Systeme analysieren große Mengen an Vertragsdaten in kurzer Zeit, erkennen Klauseln mit hohem Risikopotenzial und geben Hinweise auf notwendige Ergänzungen oder Anpassungen – etwa im Kontext des Lieferkettengesetzes (LkSG) oder regulatorischer Vorgaben wie DORA im Finanzwesen.
Aus Unternehmenssicht können KI-gestützte Prüfmechanismen helfen, kritische Inhalte schneller zu identifizieren – vorausgesetzt, sie sind richtig trainiert und in klar definierte Prozesse eingebettet. Die manuelle Prüfung umfangreicher Vertragswerke gilt als ressourcenintensiv und fehleranfällig – hier setzt die Hoffnung auf Automatisierung an.
Compliance: zwischen Versprechen und Realität
Gerade im Bereich Compliance zeigen sich die Stärken – aber auch die Grenzen – vieler Systeme. Eine automatische Klauselprüfung kann Regelverstöße aufdecken, ersetzt aber keine juristische Bewertung. Auch bestehen Risiken, wenn Systeme sogenannte „Blackbox-Entscheidungen“ treffen, deren Logik nicht nachvollziehbar ist.
Für Unternehmen ist es daher entscheidend, dass KI-Lösungen nachvollziehbar arbeiten und transparent dokumentieren, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Ohne ein sauberes Datenfundament und interne Kompetenzen droht sonst das Gegenteil dessen, was ursprünglich beabsichtigt war: mehr Unsicherheit statt Effizienz.
Datensicherheit muss oberste Priorität haben
Bei aller Innovationsfreude dürfen Unternehmen eines nicht vergessen: Vertragsdaten sind hochsensibel. Unklare Datenflüsse, versteckte Drittzugriffe oder eine Verarbeitung außerhalb der EU können nicht nur gegen geltendes Recht verstoßen, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern beschädigen.
Wer mit KI arbeitet, sollte laut Experten auf zertifizierte Anbieter setzen, die nachweislich hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards einhalten. Relevante Nachweise sind etwa das C5-Testat des BSI oder der EU Cloud Code of Conduct. Die Wahl europäischer Anbieter kann zudem zur digitalen Souveränität beitragen – ein zunehmend relevantes Thema im globalen Wettbewerb.
Fazit: KI als Werkzeug, nicht als Selbstzweck
KI im Vertragsmanagement bietet durchaus das Potenzial, Einkaufsprozesse zu modernisieren und strategisch auszurichten. Doch der Einsatz sollte wohlüberlegt sein: Erfolgreich ist, wer Prozesse und Datenlage realistisch einschätzt und Technologien gezielt einsetzt.
Unternehmen, die auf Showcases statt auf Substanz setzen, könnten enttäuscht werden. Wer jedoch das richtige Maß findet, kann mit KI nicht nur Verträge effizienter verwalten – sondern fundierter verhandeln und besser entscheiden.