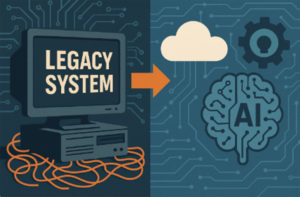HINTERGRUND Teil 3: Wer muss handeln –
USA, Europa oder die Zivilgesellschaft?

Warum eine Begrenzung der Techmacht kein nationales Projekt sein kann – und was passieren muss, damit demokratische Kontrolle wieder greift.
USA: Zwischen Regulierung und Blockade
In den Vereinigten Staaten ist die Diskussion über die Macht der Techkonzerne fortgeschritten – aber politisch tief gespalten. Während Behörden wie die Federal Trade Commission (FTC) unter Lina Khan mutige Klagen gegen Amazon oder Meta anstrengen, werden diese häufig durch politische Lobbys und gerichtliche Verfahren blockiert. Die Reform der Haftungsfreiheit von Plattformen (Section 230) ist überfällig – aber parteipolitisch vermint.
EU: Regulierungsansätze mit Nachholbedarf
Mit dem Digital Markets Act (DMA) und dem Digital Services Act (DSA) hat die EU regulatorisches Neuland betreten. Diese Gesetze schaffen wichtige Rahmenbedingungen für Marktverhalten und Moderation auf großen Plattformen. Doch es fehlt an Personal, Ressourcen und digitaler Durchsetzungskraft – und an politischer Entschlossenheit, Verstöße hart zu ahnden.
Deutschland: Digitalpolitische Ohnmacht
Deutschland redet viel über digitale Souveränität, bleibt aber in der Umsetzung weit hinter seinen Möglichkeiten. Großprojekte wie GAIA-X oder die europäische Cloud-Initiative bleiben Stückwerk. Staatliche Stellen sind vielfach abhängig von Microsoft, Google oder Amazon – ob in Schulen, Behörden oder der Polizei.
Zivilgesellschaft und Mittelstand
Ohne zivilgesellschaftlichen Druck wird keine Regierung handeln. Initiativen wie Public Money – Public Code, Digitalcourage oder dezentrale Techprojekte brauchen öffentliche Sichtbarkeit und Förderung. Auch der Mittelstand sollte sich strategisch unabhängiger aufstellen – durch Open-Source-Lösungen, eigene Plattformstrategien und digitale Kompetenzförderung.
Fazit: Die Machtbegrenzung von Digitalkonzernen ist ein globales Projekt – aber es beginnt mit mutigen Entscheidungen auf nationaler Ebene. Wer wartet, verliert Gestaltungsspielraum.
→ Nächster Teil: Die digitale Bedrohung der Demokratie – Was auf dem Spiel steht