Europas Sozialsysteme im Wandel – Teil 6:
Was Deutschland lernen kann – Ein Reformvorschlag im europäischen Spiegel
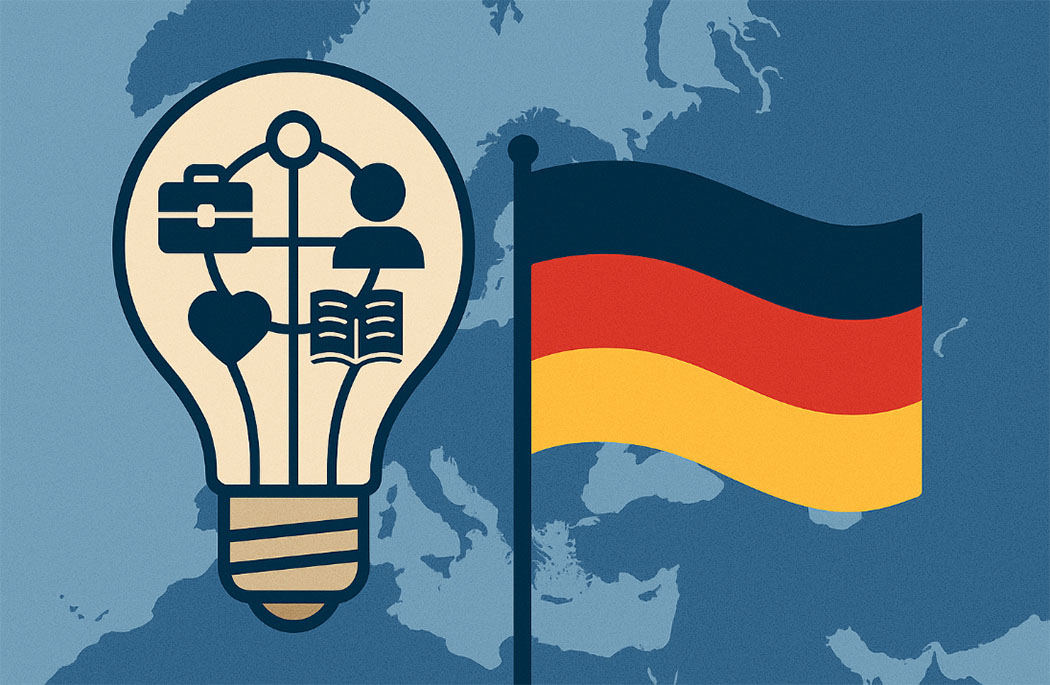
Deutschland hat kein Ausgabenproblem, sondern ein Strukturproblem. Trotz enormer Sozialausgaben bleibt der Staat oft wirkungsschwach. Die vorangegangenen Teile unserer Serie haben gezeigt, dass andere europäische Länder effizientere und bürgerfreundlichere Modelle etabliert haben. Was kann Deutschland konkret daraus lernen?
1. Weniger Zuständigkeiten – mehr Einheitlichkeit (Vorbild: Österreich)
Die österreichische Lösung mit zentralen Ansprechpartnern wie der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und digitaler Infrastruktur wie FinanzOnline zeigt: Einheitliche Verwaltungsstrukturen erhöhen Effizienz und Vertrauen. In Deutschland könnten Jobcenter, Sozialamt und Familienkasse stärker verzahnt oder zusammengeführt werden.
2. Soziale Sicherheit digital organisieren (Vorbild: Skandinavien)
Digitale Bürgerkonten wie in Dänemark („Borger.dk“) oder Schweden („Min myndighetspost“) ermöglichen transparente Kommunikation mit Behörden. Deutschland sollte ein zentrales digitales Sozialportal entwickeln, das Anträge bündelt, Leistungen verknüpft und Zugangshürden abbaut.
3. Leistungen automatisch statt auf Antrag (Vorbild: Frankreich & Dänemark)
In Frankreich wird Kindergeld oft automatisch angepasst. In Dänemark erhält jeder Bürger automatisch relevante Steuerdaten, Freibeträge oder Zuschüsse. Deutschland sollte prüfen, wie Leistungen wie Wohngeld, Kinderzuschlag oder Rentenpunkte automatisch gewährt werden können – basierend auf bereits bekannten Daten.
4. Pflege vereinfachen – Geld statt Sachleistung (Vorbild: Österreich)
Das österreichische Pflegegeldmodell erlaubt direkte Auszahlung an Betroffene. In Deutschland ist das System kleinteilig und stark reglementiert. Eine Umstellung auf klar definierte Pflegepauschalen – auszahlbar für private oder professionelle Pflege – könnte Wahlfreiheit und Transparenz erhöhen.
5. Arbeitsmarktpolitik neu denken – aktiv statt repressiv (Vorbild: Skandinavien)
Die Vermittlungspolitik des Arbeitsmarktservice (AMS) in Österreich oder der schwedischen Arbeitsverwaltung basiert auf individueller Förderung und Weiterbildung – statt Sanktionen und pauschalen Auflagen. Deutschland sollte das Bürgergeld-System evaluieren und stärker auf Kompetenzentwicklung setzen, um Menschen wirklich in Beschäftigung zu bringen.
6. Sozialstaat als Partner des Mittelstands
Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet ein effizienter Sozialstaat auch geringeren Verwaltungsaufwand. Klare Regeln, digitale Antragsstrecken und planbare Beiträge sind eine Voraussetzung dafür, dass der Mittelstand wieder verstärkt ausbildet, sozial engagiert ist – und nicht durch überbordende Bürokratie demotiviert wird.
Fazit: Weniger Gießkanne, mehr Präzision
Deutschland kann von seinen Nachbarn lernen – nicht indem es kopiert, sondern indem es Prinzipien übernimmt: Einfachheit, Transparenz, Vertrauen, Digitalisierung. Ein moderner Sozialstaat muss nicht teurer, sondern klüger werden. Und er muss zum Partner der Menschen werden – nicht zum Aktenverwalter ihrer Lebensläufe.
Im letzten Teil: Europas Sozialpolitik der Zukunft – Brauchen wir eine soziale Union?



